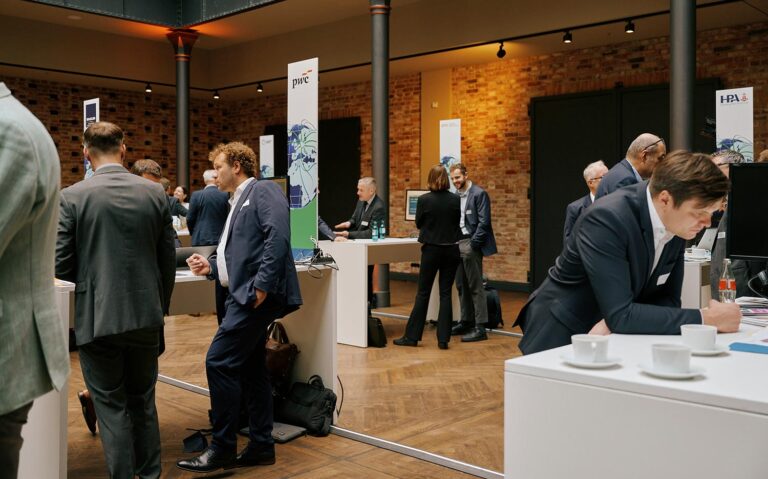Aktuelles
Erneuerbare Moleküle aus Übersee: Green Fuels Import Conference diskutiert die Zukunft der Kohlenwasserstoffbranche
Rund 200 Teilnehmende zählte die dritte Green Fuels Import Conference von en2x und WEC Weltenergierat Deutschland, die am 14. Oktober im Telegraphenamt in Berlin stattfand. Im Zentrum der Vorträge und Diskussionen stand dabei die künftige Versorgung Deutschlands mit erneuerbaren Energieträgern und Rohstoffen – jedoch auch der aktuelle Zustand der Kohlenwasserstoffwirtschaft hierzulande. Klar wurde: Damit die notwendigen Zukunftsinvestitionen getätigt werden können, muss die Politik jetzt für dafür sorgen, dass der Standort Deutschland nicht abgehängt wird.

Foto: Franz Grünewald
Aktuell führen wir hierzulande 70 Prozent der von uns verbrauchten Energie aus anderen Ländern ein – und zwar vor allem in flüssiger, gasförmiger oder fester Form, das heißt: als Moleküle, zumeist als Kohlenwasserstoffe. Daran wird sich perspektivisch nicht viel ändern. Deutschland wird auch in Zukunft weiter auf Energieimporte angewiesen sein – und auch auf die Nutzung von Molekülen. Um die Verbrennung fossiler Rohstoffe zu vermeiden und die Klimaziele zu erreichen, müssen anstelle von Mineralöl und Erdgas in Zukunft jedoch alternative Energieträger und Grundstoffe eingeführt werden. Dafür ist eine internationale Molekülwende erforderlich, die mit dem Aufbau eines globalen Markts für grüne Moleküle einhergeht. Studien zeigen, dass ein globaler Markt für grüne Moleküle zu Win-win-Situationen führen würde – mit positiven Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekten in Deutschland und in den Erzeugerländern.
Keine Resilienz ohne Importe, keine Importe ohne Moleküle
Moleküle ermöglichen den Transport erneuerbarer Energie über längere Strecken. So können Wind- und Solarstrom sowie Bioenergie aus einer Vielzahl auch weit entfernter Länder für den Standort Deutschland und die Menschen hier nutzbar gemacht werden. Energie, die ansonsten fehlen würde. Fast 80 Prozent des deutschen Endenergiebedarfs werden von Molekülen abgedeckt. Eine resiliente Energieversorgung, rollender Verkehr, wichtige Grundstoffe für die chemische Industrie: Ohne den Import von Kohlenwasserstoffen in Form von Fertigprodukten und Feedstocks zur Weiterverarbeitung in Raffinerien liefe wenig hierzulande.
„Der Bedarf wird insgesamt zwar durch Ausbau der heimischen Stromerzeugung zurückgehen, dennoch werden wohl rund die Hälfte, eventuell sogar 60 Prozent des aktuellen Absatzes an Kohlenwasserstoffen auch über 2045 hinaus noch benötigt, dann jedoch CO2-neutral und aus erneuerbaren Quellen“, berichtete Prof. Dr. Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer en2x – Wirtschaftsverband Fuels und Energie, auf der Green Fuels Import Conference. Erneuerbare Moleküle würden überall dort gebraucht, wo eine Elektrifizierung nicht sinnvoll oder nicht möglich ist, zum Beispiel im Flugverkehr und der Schifffahrt. Auch für Landmaschinen, Lösch-, Bergungs- und Militärfahrzeuge sowie Notstromaggregate werden zukünftig flexible und speicherbare Energieträger in Form von Kohlenwasserstoffen gebraucht. Dauerhaft benötigt werden Kohlenwasserstoffe zudem als Grundstoffe für die industrielle Nutzung. Sie sind wichtige Vorprodukte verzweigter Wertschöpfungsketten und sorgen so für Wohlstand und Arbeitsplätze. Dennoch sehen die Unternehmen der Energie- und Grundstoffwirtschaft hierzulande ihre Fähigkeit, im internationalen Wettbewerb erfolgreich konkurrieren zu können, zunehmend bedroht.

Nachteilige Wettbewerbsbedingungen gefährden Produktionsstandorte und Transformation
Wie andere Industrien leidet auch die Kohlenwasserstoffwirtschaft unter den derzeit nachteiligen Wettbewerbsbedingungen am Standort Deutschland. Diese sind geprägt durch hohe Strom- und Gaspreise, steigende CO2-Vermeidungskosten verbunden mit den Sonderbelastungen des europäischen Emissionshandels sowie strenge Umweltauflagen und einen hohen Bürokratieaufwand. Die Branche steht dabei aktuell vor der Herausforderung, die Anforderungen des bestehenden Systems weiterhin wirtschaftlich erfolgreich erfüllen zu müssen, um in die Weiterentwicklung und Zukunftsfähigkeit der Assets und Geschäftsmodelle investieren zu können.
„Leider wird die Bedeutung von Kohlenwasserstoffen in der Politik derzeit nicht ausreichend anerkannt. Dabei ist die Branche für Volkswirtschaft und Resilienz ebenso wichtig wie die Stahl-, Chemie- und Zementindustrie“, betonte Küchen. Hier müsse die Politik schnell für Verbesserungen sorgen, damit Wertschöpfungsketten, Arbeitsplätze und Versorgungssicherheit erhalten bleiben. „International attraktive Rahmenbedingungen sind auch eine Voraussetzung für die Molekülwende hin zu CO2-neutralen Produkten. Notwendig sind darum politische Maßnahmen, die langfristig erfolgreiche Geschäftsmodelle für Kohlenwasserstoffe als klimaschonende Energieträger und Grundstoffe ermöglichen – für die Produktion in Raffinerien hierzulande sowie für Importe, da auch künftige Lieferländer auf eine verlässliche Nachfrage für ihre Produkte angewiesen sind.“
Branchendialog mit der Politik
Als Beispiel nannte Küchen eine entsprechende nationale Umsetzung der europäischen Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III), die aktuell im Gesetzgebungsverfahren zur Weiterentwicklung der Treibhausgas-Minderungsquote für Kraftstoffe auf der Tagesordnung steht. In diesem Zusammenhang plädierte er unter anderem dafür, Co-Processing, also die gemeinsame Verarbeitung fossiler sowie biogener und anderer alternativer Einsatzstoffe in Raffinerien, auch in Deutschland vollumfänglich zu ermöglichen, damit zunehmend CO2-reduzierte Produkte möglichst kostengünstig produziert werden können wie in anderen europäischen Ländern. Ein Level-Playing-Field ist eine wichtige Voraussetzung, deutsche Standorte im internationalen Wettbewerb sichern zu können.
Hanna Schumacher, Unterabteilungsleiterin im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, sowie Antje von Broock, Leiterin der Abteilung C im Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, gingen im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit Küchen sowie Michael Kellner, MdB (Bündnis 90/Die Grünen), Sprecher für Energiepolitik, nicht auf Details des aktuellen Gesetzgebungsprozesses ein. Die Regierung habe ein offenes Ohr, wenn es um die Gestaltung der Rahmenbedingungen gehe, Investitionen müsste die Branche dann jedoch selbst vornehmen. Schumacher sagte diesbezüglich eine baldige Fortsetzung des Branchendialogs zur Transformation zu. Dieser Austausch zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium und en2x-Mitgliedsunternehmen wurde im April 2024, noch unter der damaligen Ampelregierung gestartet, und war bereits ein Thema auf der letztjährigen Green Fuels Import Conference. Als ein erstes Ergebnis des Dialogs hat das Ministerium im März 2025 einen Bericht vorgelegt, für dessen Erarbeitung rund 30 umfassende Gespräche geführt wurden, auch mit Verbänden und der Gewerkschaft IGBCE. Nachdem die Zuständigkeiten im Bundeswirtschaftsministerium nun neu geregelt wurden, stellte Schumacher Folgegespräche noch im vierten Quartal dieses Jahres, spätestens aber zu Jahresbeginn 2026, in Aussicht.
Michael Kellner, in dessen Wahlkreis sich eine der großen ostdeutschen Raffinerien befindet, betonte deren grundsätzliche Zukunftsfähigkeit. Das sei auch wichtig: „Neue Geschäftsfelder müssen entstehen, damit gute Arbeitsplätze erhalten bleiben.“ Schon zuvor hatte Malte Küper, Senior Economist für Energie- und Klimapolitik, Themencluster Digitalisierung & Klimawandel, Institut der deutschen Wirtschaft Köln, in seinem Vortrag „Hydrogen, E-Fuels und Carbon Management“ darauf hingewiesen, dass Moleküle und Importe unverzichtbar bleiben, dem Hype – gerade im Hinblick auf grünen Wasserstoff – mittlerweile jedoch, nicht nur hierzulande, eine gewisse Ernüchterung gefolgt sei. „Nur ein Bruchteil der angekündigten Projekte wird bis 2030 realisiert. Gerade Schwellen- und Entwicklungsländer bleiben aus finanziellen Gründen weit hinter den Ankündigungen zurück“, so Küper. Vor allem eine fehlende gesicherte Nachfrage bremse den Markthochlauf. Ein weiterer Trend: Viele Exportprojekte setzen auf Ammoniak und Methanol – nicht mehr auf reinen Wasserstoff.

Von der Theorie zur Praxis
Damit aus großen Ambitionen auch konkrete Aktivitäten entstehen können, werden Netzwerke und Partnerschaften benötigt. Das wurde auf der Green Fuels Import Conference nicht nur wiederholt auf dem Podium ausgesprochen, sondern auch gleich vor Ort in die Praxis umgesetzt. Unternehmen und Forschungseinrichtungen stellten sich und ihre Kooperationsangebote, Initiativen oder Projekt und Studienergebnisse an Topic-Tables vor. Vor allem in der Mittagszeit gab es so viel Zeit und Raum für zielgerichtetes Networking und Matchmaking.
Am Nachmittag stand die Veranstaltung dann ganz im Zeichen der Themenschwerpunkte „Wasserstoff“ und „Kohlenstoffkreisläufe“. Die Wasserstoffelektrolyse ermöglicht es, Strom aus erneuerbaren Energien in speicherbare grüne Moleküle zu verwandeln. Grüner Wasserstoff und seine Derivate sind daher von enormer Bedeutung, um die Transformation zu mehr Klimaschutz voranzubringen und einen globalen Markt für grüne Moleküle zu etablieren. Per Live-Schaltung nach Brüssel meldete sich zunächst Jorgo Chatzimarkakis, CEO, Hydrogen Europe, zu Wort. Er kritisierte unter anderem, dass Europa sich beim Hochlauf von grünem Wasserstoff zwar ehrgeizige Ziele setze, sich in der Umsetzung aber durch Überregulierung und damit einhergehende Kostensteigerungen schwertue. Statt sich in Details zu verheddern, seien vielmehr klare, konsistente Rahmenbedingungen nötig, damit potenzielle Investoren mehr Planungssicherheit erhalten. Ansonsten drohten Deutschland und die EU den Anschluss an globale Konkurrenten wie zum Beispiel China zu verlieren.
Verzögerungen bei grünem Wasserstoff
Dirk Niemeier, Director Strategy & Germany, Lead Clean Hydrogen and Alternative Fuels, PricewaterhouseCoopers, warf in seinem Impuls einen Blick auf die aktuelle Lage auf dem Wasserstoffmarkt und bekräftigte in mancherlei Hinsicht die Worte seines Vorredners. Als Gründe für die Verzögerungen beim Hochlauf von grünem Wasserstoff machte er insbesondere unzureichende Abnahmevereinbarungen, Unsicherheiten bezüglich der notwendigen Infrastruktur, eine zu komplexe und restriktive Regulierung, unzureichende Anreize sowie eine zu teure Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien aus. Die politischen Entscheidungsträger seien daher aufgefordert, die europäische Wasserstoffwirtschaft durch eine Optimierung des Rechtsrahmens zu stärken.
Von praktischen Erfahrungen berichtete Frank Schnitzeler, Senior Large Project Business Development Manager, Air Products, einem Unternehmen, das zu den weltweit führenden Anbietern von Wasserstoff zählt und dabei bereits im großen Stil auf erneuerbaren Wasserstoff setzt. Schnitzeler referierte dementsprechend über die „Dekarbonisierung des deutschen Mobilitätssektors mit erneuerbarem Wasserstoff und Ammoniak im industriellen Maβstab“. Auch er kam auf die notwendige Verbesserung der bestehenden Rahmenbedingungen zu sprechen und plädierte unter anderem für eine zügige Umsetzung der RED III, eine zeitgerechte Fertigstellung des H2-Netzes sowie verlässliche und langfristig stabile Rahmenbedingungen für Investoren.
Defossilisierung braucht Kohlenstoff
Ebenso wichtig wie Wasserstoff sind seine Derivate, insbesondere Kohlenwasserstoffe, die sich einfacher speichern und transportieren lassen. Die Nutzung von Kohlenstoff wird daher weiterhin notwendig sein. Dabei ist dem Klimaschutz nur gedient, wenn kein fossiler Kohlenstoff mehr als Treibhausgas in die Atmosphäre entlassen wird. Defossilisierung, nicht Dekarbonisierung lautet demnach das Ziel der Molekülwende hin zu erneuerbaren Verbindungen und weg von Mineralöl und Erdgas.
Das machte auch Torsten Schwab, Director (Technology) of International PtX Hub, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) deutlich, der einen Impulsvortrag mit dem Titel „Defossilisierung braucht Kohlenstoff – aber erneuerbar und global gedacht“ hielt. Schwab betonte, dass erneuerbarer Kohlenstoff keine Punktquelle ist und sich daraus entsprechende Herausforderungen ergeben. „Diese dezentrale Welt mit der zentralen Weiterverarbeitung zusammenzubringen, wird noch Arbeit erfordern“, so Schwab. Er beschrieb in seinem Vortrag die Möglichkeit einer kosteneffizienten Beschaffung von erneuerbarem Kohlenstoff aus dem globalen Süden unter Verwendung modularer, typgeprüfter und serienmäßig hergestellter Anlagen. Als Quellen kämen zum Beispiel Pflanzenschalen und Hüllblätter, Lebensmittelverarbeitungsrückstände, Fermentation, Klärschlamm und Biogas in Betracht. Zusammen mit grünem Wasserstoff könnte so im globalen Süden erneuerbares Methanol erzeugt und nach Deutschland verschifft werden.
Kohlenstoffabscheidung und chemisches Recycling
Eine weitere Möglichkeit, Kohlenstoff zu gewinnen, um ihn danach weiter zu verarbeiten, besteht in dessen Abscheidung aus vorhandenen industriellen Prozessen. Darauf ging Nikolaus Widmann, Executive Vice President, Tree Energy Solutions GmbH (TES), in seinem Impuls ein. Er stellte dabei insbesondere die Möglichkeit vor, aus grünem Wasserstoff mit recyceltem CO2 synthetisches Erdgas (e-NG) herzustellen. Chance, Risiken und Leitprinzipien von Carbon Capture und Utilization (CCU/CCS) standen dann im Zentrum des Vortrags von Luisa Keßler, Policy Advisor Sustainable Hydrogen Economy, Bellona Deutschland. Sie forderte, dass CCU-Konzepte aus Klimaschutzgründen entweder eine langfristige CO2-Bindung oder eine zumindest bilanziell geschlossene Kreislaufführung gewährleisten müssten. Aufgrund des erheblichen Energiebedarfs sollte diese CO2-Nutzung auf Anwendungen mit wenigen oder keinen Alternativen beschränkt werden. Der dafür eingesetzte erneuerbare Strom müsse zusätzlich zu bestehenden erneuerbaren Kapazitäten bereitgestellt werden.
Chemisches Recycling ermöglicht es, Kohlenstoff aus Abfallprodukten wie Kunststoffen in chemische Grundstoffe zurückzuführen, anstatt sie zu verbrennen oder zu entsorgen. Dieses Thema wurde von Beate Edl-Gettinger, Project Director Regulatory & Business Development, Circular Economy, OMV Downstream, in ihrem Vortrag „OMVs Reoil® Technologie: Die Rolle des chemischen Recyclings für eine kohlenstoffbasierte Kreislaufwirtschaft – Erfahrungen und Perspektiven“ eingehender betrachtet. OMV verfolgt als global tätiger Energie- und Chemiekonzern das Ziel, bis 2030 ein führendes, integriertes Unternehmen für nachhaltige Chemikalien, Kraftstoffe und Energie zu werden. Chemisches Recycling, so Edl-Gettinger, kann dazu beitragen, die Lücke beim Recycling von gemischten Kunststoffabfällen zu schließen und dadurch einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten. Es ermögliche die Herstellung von Monomeren – also kleinen, reaktionsfreudigen Molekülen, die sich durch chemische Reaktionen zu langen Ketten oder Netzen, sogenannten Polymeren, verbinden können – in Neuwarequalität, die für sensible Anwendungen wie Lebensmittelverpackungen geeignet sind.
Die Veranstalter konnten am Ende ein positives Fazit ziehen. Das Publikumsinteresse hatte im Vergleich zu den Vorjahren noch einmal zugenommen. Bis zum Schluss der ganztägigen Veranstaltung, die mit einem Get-Together ausklang, waren die Sitzreihen gut gefüllt. Zahlreiche Fragen, die aus dem Auditorium an die Vortragenden gerichtet wurden, zeugten von der Relevanz der diskutierten Themen. Auch wenn sich im Laufe der Veranstaltung immer wieder zeigte, dass die Herausforderungen immens sind, zeigte sich Dr. Carsten Rolle, Geschäftsführer, Weltenergierat – Deutschland, am Ende doch optimistisch. Eine andere Möglichkeit gäbe es im Hinblick auf die grünen Moleküle auch kaum: „Wir sind zum Erfolg verdammt.“
Alle freigegebenen Vorträge zu den oben genannten Themen finden Sie hier.